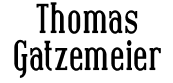Ein Balkon bei Assisi
Sie müssen wissen, ich bin Kunstwissenschaftler. Einer der wenigen Männer in diesem Beruf.
Neunzig Prozent meiner Kollegen sind weiblich und auch ohne jegliche Perspektive.
Ärgerlich ist es, dass es nicht genügend gut verdienende Männer gibt, deren geistiger Horizont es erlaubt, diese meist wohlgesitteten und durchaus gebildeten Frauen zu ehelichen.
Mir ist nach vielen Gelegenheitsjobs in Museen, der Arbeit an verschiedenen kleineren Publikationen und Katalogtexten für Künstler, die ich weder richtig kannte noch jemals kennenlernen wollte, ein verlockendes Angebot gemacht wurden. Ich weiß nicht, warum man ausgerechnet auf mich kam, denke aber, dass bei dem unverschämt niedrigen Honorar kaum ein Besserer zu finden war.
Wenn ich irgendwie im Geschäft bleiben will, muss ich diese erniedrigende Sklavenarbeit machen oder aufs Amt gehen, das jetzt Agentur genannt wird. Für eine Umschulung ist es ohnehin zu spät.
Erzürnt hat mich, dass meine Mitarbeit schon durchgesickert war, ehe überhaupt die Finanzierung des Projekts stand. Denn der Verlag gibt nur seinen Namen und übernimmt die Gestaltung und das Schlusslektorat. Mit anderen Worten stellen diese lediglich den Korrektor und deren Grafiker schiebt Bilder auf InDesign hin und her.
Was jetzt ein ein Balkon bei Assisi ist natürlich besonders spannend.
Der Projekttitel „Neue Kunst im Heute“ ist so was von gestern, das ich erst gar nichts dazu sagte.
Von einem Treuhandkonto kam sehr rasch die erste Rate für mich. Hätte ich nicht von meiner Tante, zu der ich vor Ihren Tod ein exemplarisches Nichtverhältnis hatte, eine kleine Erbschaft gemacht, wäre die Reise nach Umbrien für mich auch trotz es Honorarvorschusses unmöglich gewesen.
Bei Thomas hätte ich sicher Asyl gefunden, bis Elke bei mir ausgezogen wäre.
Wenn ich zurückkomme, woran ich nicht denken möchte, muss auch ich jedoch selber bei uns ausziehen. Denn ich kann mir diese 250 qm Gründerzeitwohnung auch nicht leisten. Sitze jetzt aber auf einem Balkon. Dies ist ein Balkon bei Assisi. Der Balkon eines alten Wirtschaftsgebäudes auf einem Olivenhain. Dieser grenzt direkt an die Stadtmauer von Assisi. Froh dem Ganzen für eine gewisse Zeit entkommen zu sein, denke nach, was jetzt zu tun sei.
Ich bin aber mit mir zornig, weil ich in den zwei ersten Wochen hier Erkenntnisse gewonnen habe, die mir in den vergangenen zwanzig Jahren nicht in den Sinn kamen.
Enthusiastisch wie ein verblödetes Groupie bin ich den Moden dieser rasenden Kunstszene bis vor Kurzem hinterhergerannt. Natürlich habe ich nicht gemerkt, dass nur drei, vier Akkorde gespielt werden und die lautesten Trommeln mit falschen Häuten bezogen sind. Verrückt gebärdet sich der Kunstmarkt – als gäbe es kein Morgen.
Von der permanenten Anmaßung der Solisten dieses schrägen Spiels gar nicht zu sprechen.
Das Orchester folgt ohnehin ohne zu murren jedem vorgegebenen Takt. Und die Spekulanten hecheln mit tropfenden Lefzen jedem Narren hinterher.
Wenn ich Richtung Norden schaue, kommt gleich hinter dem Olivenhain die Stadtmauer von Assisi. Ein paar Kilometer weiter liegt Perugia in den Bergen. Ich sehe abends aber lediglich die Lichter von della Pieve drüben im Westen, und die der anderer kleiner Dörfer, deren Kirchen mit Kunst nur so vollgeschissen sind.
Zu Fuß laufe ich lediglich eine halbe Stunde und ersaufe schon in der der Kunst des „Erfinders der modernen Kunst“. In den zahllosen Giottos der Basilika San Francesco.
Ich meine nicht das Konfekt. Diese widerlichen Knusperkugeln mit der schleimigen Süßmasse als Kern, von denen man immer zu viele frisst, weil die in den Dingern versenkten Geschmacksverstärker das Hirn ausschalten.
Lebensmittelingenieur scheint ein ähnlicher Beruf zu sein wie der eines Kurators.
Man sucht sich Ingredienzien und versucht sie so anzuordnen, dass der Betrachter betört wird. Auch wenn es nur Belanglosigkeiten sein sollten, die Namen müssen zumindest ein wenig stimmen. Noch einfacher haben es diejenigen, welche aus den vollen schöpfen können und die Welthitparade hoch und runter ableiern können.
Viele Stunden habe ich mir die Fresken angesehen und noch einiges von Perugino. Da macht man sich schon Gedanken. Auch wenn die eingefleischten Vorstellungen von Kunst und Zeit dabei zerstört werden und man schnell merkt, dass wir eigentlich in einer kulturlosen Zeit voller Banalitäten leben.
Für mich als Theoretiker ist das ja in Ordnung.
Für einen Künstler muss solch eine Erkenntnis jedoch nahezu tödlich sein. Zumindest wenn er überhaupt in der Lage ist, das aufzunehmen. Also. Wenn er überhaupt was merkt. Denn Künstler kann man heute nur werden, wenn man schon von sich überzeugt ist, bevor man den Pinsel oder Stift in die Hand nimmt. Es gibt subtile Schutzmechanismen, um die Künstlerseele vor Blessuren zu bewahren. Was ist eigentlich ein Künstler. Doch wohl lediglich eine Behauptung. Oder?
Dass Elke mich schon lange nicht mehr ertrug, habe ich nicht gemerkt.
Es wurde einfach immer ruhiger zwischen uns im Bett und auch sonst. Sich häufende kleine eruptiv-grundlos, ausbrechende Streitereien, nach denen ich in die Kneipe geflohen bin und mir das Hirn ausgeknipst habe, kündigten das Ende an. Alles eine Frage der Zeit. Vor zwei Jahren überlegten wir, ein Kind zu zeugen und aus der Stadt raus aufs Land zu ziehen. Mecklenburg Vorpommern.
Sie ist Kunsterzieherin. Eigentlich Künstlerin.
Zwei mehr oder weniger Gescheiterte leben zusammen. Das geht nicht lange gut und ist auch für die Zukunft nichts. Kennengelernt hat sich mich (oder ich Sie), als ich eine Gruppenausstellung junger Künstler zu kuratieren hatte. Denn weil das Museum diese Aufgabe nicht den eigenen Leuten zumuten wollte und auch um die Verantwortung dafür nicht zu übernehmen müssen, haben sie mich als Externen engagiert.
Die Ausstellung war von der Stadt so gewünscht, wie sie auch wurde. Also haben die einen Freiberufler von der Straße genommen, der den Scheiß macht. Und ich bin bekannt dafür, alles anzunehmen. Irgendwie muss man ja bekannt werden. Und eben auch überleben.
Die Sache mit Elke ist nach der Vernissage passiert. Ich hab sie mitgenommen. Damals noch in meine WG. Die Ausstellung nannte sich „Kunstblut“.
„Kunstbrut“ hätte besser gepasst. Heute kennt keiner mehr auch nur einen der Teilnehmer. Elke war damals so eine sanfte, anschmiegsame. Eine, die Seerosen nicht nur von Monet mochte.
Montags und Freitags fahre ich generell nicht mit dem Auto. Also begann ich meine Reise an einem Donnerstag Mitte Juni. Von Berlin bin ich nach Freiburg in das Vauban gefahren, um bei einem Freund und Studienkollegen zu übernachten, der da eine Professur hat und neuerdings auch eine viel jüngere Frau. Und zwei kleine Kinder. Schütteres, graues Haupthaar hat er und einen stetig dünner werdenden Zopf.
Von ihm stammt der Begriff Deflexionsmonochromismus. Dieser Terminus beschreibt die Verdrängung der Farbe aus dem Bild und erhebt diese Reduzierung zu einem künstlerischen Akt des Selbstverzichts. Askese im Widerpart zur Konsumkultur.
Seine Habilitation wurde damals von den 68ern bejubelt und eine Renaissance nicht nur in der Schwarz-weiß Fotografie in Aussicht gestellt. Man wartete auf einen neuen Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch, den ewigen Säulenheiligen der Moderne mit seinen heute bei einigen wenigen Hipstern als Zeichen von Intellektualität an der Wand hängenden Bildern.
Anstatt seiner Inkarnation kamen jedoch die Väter der jungen Wilden und alles wurde sehr farbig, um nicht bunt zu sagen.
Denn es wurden Kissen bunt eingefärbt und mit mehrere Meter in der Länge messenden Rakeln feine Ölfarbe auf sehr große Leinwände verteilt. Die Genialität des Dilettanten wurde beschworen.
Seit damals ist mein Kommilitone groß im Geschäft, züchtet sich willfährige Assistentinnen, die ihn vertreten, wenn er seinen Nebenjobs als Gutachter, Kurator, Sammlungsberater und Jurymitglied nachgeht.
Eigentlich gibt es seit Jahren keine Jury, in der er nicht sitzt.
Manchmal betätigt er sich auch als Kunsthändler oder zumindest Zwischenhändler. Aber so richtig weiß das natürlich keiner und wir sprechen auch nicht darüber. Die Bilder an seinen Wänden sind vom Feinsten. Warum er Sie sich mit seiner alten C4professur, der jungen Frau und den zwei neuen Kindern solche Bilder leisten kann, kann man sich denken.
Als ich bei ihm ankam, saß er auf dem Balkon und arbeitete an den Unterlagen für den Beitrag Deutschlands zur Biennale in Sao Paulo. Er bot mir eine geeiste Weißweinschorle an. Barfuß war er, ziemlich gebräunt und mit einem Trägershirt bekleidet.
Die in unserem Alter überall auftretenden Fältchen konnte auch er nicht wegbügeln. Ansonsten sah er topp aus wie fast alle Leute, die in abgesicherten Verhältnissen leben und ihren Schwanz, wenn sie Lust haben, jeden Abend in junges Fleisch stecken können.
Die Pergola war von Daniel Buren.
Nachdem er gefragt hatte, ob der ICE pünktlich war, und ich sagte, ich sei mit dem Auto gekommen, sah er mich missbilligend an und fragte besorgt, ob ich die Kiste auch nicht in der gesperrten Zone abgestellt hätte.
Ob er seinen Führerschein verloren hätte, fragte ich, und wo sein alter SL mit dem roten Leder sei. Alles Vergangenheit, meinte er, und das Haus in Südfrankreich haben wir auch verkauft, sagte er. Es ist einfach unvernünftig. Zu unserer Pariser Wohnung kann man gut mit dem TCV kommen. Da hat er recht – dachte ich und grinste.
Er fragte mich mehr aus Höflichkeit nach wie es bei mir läuft. Denn er kannte mein berufliches Dilemma nach meinen mehr oder weniger gefloppten und aktuellen Scheißprojekten.
Ich erzählte also von dem geplanten Buch und schon war er hellwach und versprach mir eine – seine derzeitige Topkünstlerliste. Ich beeilte mich zu betonen, dass ich darauf keinen Einfluss habe, und deutete an, dass die Teilnehmer von anderer Seite „empfohlen“ werden und war froh ihm nicht erklären zu müssen, was ich über wen wie schreibe und mir seine ausufernden Darlegungen anhören zu müssen, die mir wieder eindeutig zeigen, dass er das umfänglichere Vokabular besitzt, um ein Nichts zu beschreiben und danach auf dem Altar der Kunstwissenschaften abzulegen.
„Es gibt eine zentrale Koordinationsstelle, welche in einer Berliner Galerie untergebracht ist“ benutze ich als Ausrede.
Er schmunzelte und sagt. Ah-ha! Welche? Das wusste ich noch nicht und ich war sowieso laut Vertrag zur Verschwiegenheit verurteilt. Wollte ich nicht für immer aus dem Geschäft fliegen, muss ich diesen Passus zu einhundert Prozent einhalten und den Leuten auch sonst in den Arsch kriechen. Noch nicht einmal den Deut eines Verdachts oder des Zweifels an einem der Qualität der beteiligten Künstler darf es geben.
Es zog ein typisch Freiburger Unwetter auf. Feuchtwarm, Sturm und Regen aus Gießkannen. Der Himmel waberte in einem Blauschwarz über die Vogesen. Ergoss sich in die Rheinebene, um anschließend am Schwarzwald abgefangen zu werden. Um sich da wettermäßig auszukotzen zu können.
Seine neuen Kinder kamen zusammen mit einer wahrhaft schönen, fast noch kindhaften, Frau und durchnässt von dem Regen und dem Wasser des Dorfbachs, dem kleinen Flüsschen ganz in der Nähe, überfallartig in die Wohnung. Erst dachte ich, es sei ein Au pare. Jenes war jedoch älter als die Mutter und trottete erschöpft in die Wohnung, nachdem es die Spielzeuge und den Kinderwagen unten am Eingang verstaut hatte.
Judith hieß seine Neue und sah wie Sarah aus.
Die Kinder – ein Junge ungefähr 4-5 und ein entschieden kleineres Mädchen hatten sich als kleine auf Beinen laufende Schlammklumpen verkleidet. Sie hatten an der Dreisam im Uferschlamm gewühlt wie Bisamratten. Den Kindern nach zu urteilen hatte ich meinen Studienkollegen an die 4 oder 5 Jahre nicht mehr besucht. Hin und wieder traf ich ihn jedoch in Berlin. Er betreute unter anderem auch die Kunstsammlung der Bundesrepublik Deutschland und schrieb für einige Berliner Galerien Katalogtexte.
Die Kinder des auf die Emeritierung wartenden Professors rannten durch die Wohnung und machten einen markerschütternden Lärm, weil sie unter die Dusche sollten und nicht wollten. Also war klar, dass ich mit einem stärkeren Tinnitus hier abfahren würde, als ich angekommen war.
Während das Au pare die Wänster zu bändigen suchte, setzte sich seine Judith zu uns und fragte, ob der ICE Verspätung gehabt hätte. In der Art wie sie lächelte, kam sie mir vor als hätte sie was geraucht. So abwesend war sie und vergeistigt. Ihre Haut die einer Albinoschlange.
Sie schwieg, und wir Männer versuchten uns über aktuelle Tendenzen auszutauschen, was aber nicht nur wegen des Lärmes, den die Kinder veranstalteten, nicht gelang, sondern weil die schlangenhäutige Porzelanfrau neben uns störte.
Ich mache sowieso, was reinkommt und so richtig kümmere und interessiert mich der Kunstbetrieb ohnehin nicht mehr. Vor ein paar Wochen munkelte man, die indische Kunst würde weltweit eine größere Bedeutung gewinnen. Jedenfalls sei das an den Auktionsergebnissen klar abzulesen.
Ihr Au pare war Polin. Der Kleinen werdenden Terroristen werden den Eltern noch viel Freude bereiten. Dachte ich.
Ich entschloss mich, in die anbrechende Nacht hinein bis nach Bergamo zu fahren und dort irgendwo ein Hotel zu suchen.
Erst als ich in den Sankt Gotthard einfuhr, legte sich meine Anspannung und ich fragte mich, wie er das aushält. Eigentlich interessierte mich das nicht, da es mir als Kinderlosen ohnehin nicht gelingt, so ein Leben nachzuvollziehen. Und ohnehin geht mich das nichts an.