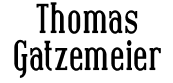Das Museum in Lyon ist einen Besuch wert!
Lyon ist auf der Kunstweltkarte nicht unbedingt an vorderster Stelle zu finden. Auch ich bin mehrmals in Dankbarkeit an dieser Stadt in Richtung Provence vorbeigefahren, signalisierte sie doch, das ungefähr die Hälfte des Weges geschafft ist. Man meint, gehört zu haben, Lyon sei irgendeine Industriestadt, die auch einer Wurst Ihren Namen geben hat.
Uns sollte Lyon lediglich zur Ruhe vor der Weiterreise dienen.
Dann war nicht nur die Stadt eine große Überraschung. Das Musée des Beaux-Arts in Lyon ist unbedingt einen Besuch wert. Im internationalen Konzert der großen Häuser spielt es kaum eine Rolle. Doch die Sammlung dieses Museums besticht durch einige sehr feine Arbeiten. Und dies quer durch die Kunstgeschichte bis in die nähere Vergangenheit.
Der Vorteil als Museum nicht in aller Munde zu sein, liegt eindeutig auf der Seite des Besuchers. Man steht nicht an und kann die Kunstwerke in aller Ruhe genießen.
Gleich beim Betreten des Museums wurde ich von einem alten Bekannten überrascht. Perugino, den ich bei einem Aufenthalt in Umbrien neu entdeckte, protzt mit einer Auferstehung Christi und erfüllt den Eingangsbereich mit einem besonderen Glanz.
Der Lehrer Raffaels hat dieses großformatige Bild konsequent symmetrisch komponiert. Aber nicht daran oder an seinem Kolorit erkenne ich Pietro Perugino auf den ersten Blick.
Die Unterkiefer seiner Porträts sind es. Geradezu ein Markenzeichen, jedoch anatomisch nicht unbedingt normal. So wie Michelangelos Frauen eigentlich Männer sind, denen er lediglich die sekundären Geschlechtsmerkmale „drangemalt“ hat, wie zum Teil an den Sibyllen in der Sixtinischen Kapelle zu sehen. Oder Lucas Cranachs Damen-Bäuche, die ein regelrechtes Markenzeichen sind. Jeder Künstler hat seine individuellen Eigenheiten und wird so unverwechselbar.
Nur der Kopist geht „glatt“ durchs Leben und verbreitet Langeweile.
Es grenzt an das Unmögliche. Man kann nicht alle Künstler aller Epoche kennen. Mich würde dies auch ängstigen und vor allem langweilen.Wäre doch jede Entdeckung ausgeschlossen. Lorenzo Costa malte Ende 1400 eine Christi Geburt. Dies ist ein ausgesprochen feines Bild von höchster zeichnerischer Qualität.
Kompositorisch klar gegliedert öffnet sich die Malerei in eine extreme perspektivische Tiefe.
Im Lyoner Museum ist auch ein grandioser Tintoretto zu bewundern. Dieses Gemälde ist an die hundert Jahre später – so gegen 1570 – entstanden und um einiges malerischer als das Gemälde von Costa.
Aber wie sollte man diese gegeneinander aufrechnen? Was ist besser. Was ist schlechter. Solche Kategorisierungen sind untauglich, da es sich hier zwei malerische Grundhaltungen manifestieren, die sich durch die gesamte Kunstgeschichte ziehen.
Einerseits der zeichnerische, auf der Linie basierende Ansatz und andererseits der „malerische“ Ansatz, der das Sfumato benutzt. Einfach übersetzt die verschwommene Darstellung der Konturen.
Costas Gewänder sehen brillant und klar aus. Die Binnenform und die Außenform ist zeichnerisch klar voneinander abgegrenzt.
Bei Tintoretto ist alles im Fluss. Was seine Fleischlichkeit angeht, meint man schon Rubens zu sehen, der erst 1577 geboren wird. Also 7 Jahre nachdem Tintoretto „Die Danae“ malte, welche im Museum von Lyon sicher einen Höhepunkt darstellt.
Die Steinigung des Heiligen Stephanus von Rembrandt erkannte ich erst auf dem zweiten Blick als Arbeit von seiner Hand.
Auf das Schild geschaut. 1625. Und dann. Zweitens. Mit dem Smartphone bei Google nachgesehen. Rembrandt hat dieses Gemälde – wenn sich die Kunstwissenschaftler nicht irren, – im zarten Alter von 19 Jahren gemalt. Ein Jahr nach Abschluss seiner Lehre bei Pieter Lastmann. Natürlich ist dieses Gemälde noch sehr von seinem Lehrer geprägt.
Ich möchte meine Arbeiten mit 19 Jahren jetzt nicht sehen. 😉
Zu meiner Entlastung sei angemerkt, dass Rembrandt mit 19 schon eine fünfjährige Ausbildung hinter sich hatte. Trotzdem – er ist einer der größten Künstler aller Zeiten. Und schön solch eine frühe Arbeit zu sehen. Mehrere derartige Überraschungen sollten noch auf uns zukommen.
Irgendwann ging es dann einige Stufen nach unten. Nicht in den Keller. Ein opulenter Skulpturensaal öffnete sich.
Da hatten wir die Bildhauer, die sich vor und nach Rodin am menschlichen Leib abarbeiteten. Rodin der Omnipräsente ist im Museum von Lyon eher unterrepräsentiert. Ein früher, eher nicht so aufregender, Rodin musste reichen. Denn ohne diesen französischen Meister geht garnix. Die anderen Plastiken hatte auch deshalb Raum zur Entfaltung, weil sie nicht von diesem omnipotenten Meister in die Ecke gedrängt werden konnten.
Die Odalisque von James Pradier, den ich auch nicht kannte, gefiel mir sehr gut. Wie sie sich umwendet, ist mit großer Anmut und gekonnt aus dem Marmor herausgearbeitet. Reinster Klassizismus von erstklassiger Qualität die man nicht so schnell vergisst.
Allerdings fand ich es sei eine verpasste Gelegenheit, dass man die Sitzende vom Maillol nicht in eine Beziehung mit der Odaliske gebracht hat.
Die Bezüge hätten sich angeboten und mit Traditionslinien verbunden, die für die Bildhauerei stilbildend sind. Moderner oder gar abstrakt wurde es dann in diesem sehr schönen Raum Gott sei Dank nicht. Ein schönes Beispiel, wie Kunst und Architektur eine Symbiose eingehen kann.
Ein Saal zum Verweilen. In Ruhe sitzen zu können und spüren, wie man innerlich entspannt.
Eine – nicht ganz leise – Schulklasse bewegte uns dazu weiterzuziehen. Der Treppenaufgang mit seinen Wandmalereien erinnerte mich an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.
Ein erster intensiver Blick im oberen Stockwerk des Museums von Lyon fiel auf eine Welle von Gustave Courbet. Ein kräftiges Bild.
Les amants heureux, dieses Doppelporträt ist meiner Meinung nach um einiges bedeutender. Fantastisch gelöst und sehr spannungsvoll durch das vordere im Halbschatten liegende männliche Porträt und das Lichte dahinter. Mithilfe dieser malerischen Elemente erzeugt Courbet nicht nur Tiefe, sondern auch eine enorme Spannung. Das Geflecht der Linien, der Konturen der zwei Dargestellten verstärken die Komposition und heben ihr Halt. Kleines Bild mit wahnsinniger Power.
Jean Paul Laurens Gemälde dieser zwei Kinder war auch eine der großen Überraschungen.
Eigentlich als ein Historienmaler theatralischer Natur bekannt, zeigt der Maler hier, wie man Ruhe darstellt. Dieses Bild ist subtil, farbig und kompositorisch äußerst spannungsvoll. Jedoch ohne lärmend spektakulär zu sein. Einer der letzten großen Historienmaler beweist hier, dass er auch das kleine Format meisterlich beherrscht.
Natürlich kommt man um die historisierende Salonmalerei auch in diesem Museum nicht herum.
Da geht es wild-theatralisch zur Sache. Das lärmende Großformat an sich war in bestimmten Kreisen schon immer begehrt, stellte es doch nicht nur sich selbst, sondern auch den Besitzer in ein besonders helles Licht. Dem Namen des Malerfürsten wurde natürlich besondere Bedeutung zugemessen. Die Qualität solcher Riesenschinken spielt nicht immer die erste Rolle. Hauptsache, es knallt richtig.
Dies ist kontinuierlich und in unserer Epoche wieder von herausragender Bedeutung. Big is Beautiful. Hat aber nicht das Geringste mit Qualität zu tun.
Unwesentliche Schritte weiter drei schöne Gemälde von Daumier. Malerisch sehr schön. Und ein gravierender Gegensatz zur repräsentativen Malerei. Denn dieser Künstler wendet sein Augenmerk auf sozialkritische Themen und stellt mit Vorliebe das einfache Volk dar. Auch hatte Daumier einen engen Kontakt zur Schule von Barbizon was man an dem Duktus seiner Malerei unschwer erkennt.
Hier schafft das Museum Einträchtigkeit in der Vielfalt. Dominante Positionen werden abgeschliffen und relativiert. Man wünschte sich, dass zeitgenössische Museumsleute und Kuratoren mit mehr Demut ans Werk gehen und sich nicht leichtfertig einem Mainstream hingeben, um ihr eigenes Ansehen zu steigern.
Denn immer noch ist es so, dass der Künstler das Gesetz macht und der Theoretiker die Interpretation.
Die Tendenz, dass die Theoretiker Kunst lediglich als ein formbares Material – als Objekt – für ihre Zwecke benutzen, ist verheerend und wird die Szene und das Publikum gravierend verändern. Der Überdruss an der Kunst wird überall spürbar.
Ganz am Anfang unseres Rundgangs hatten wir schon einen sehr frühen Rembrandt. Hier kommt noch ein früher van Gogh hinzu.
Es sind nicht die kleinsten Andeutungen seiner zukünftigen Farbgewitter zu sehen. Kein Wetterleuchten, sondern die erdige, bäurische Malerei aus der Zeit, in der er die Kartoffelesser gemalt hat. Noch ein Frühchen eines ganz großen Meisters.
Irgendwie zur gleichen Zeit, wenn auch 30 Jahre früher geboren, lebte der Maler Puvis de Chavannes. „Warst du in Italien, so kannst du auch gut malien“ hat man vor vielen Jahren in das Gästebuch einer Ausstellung von Werner Tübke geschrieben. Tübke genoss als Genosse zu DDR-Zeiten Reisefreiheit und schulte sein Auge an der Renaissance.
Puvis de Chavannes packte die Malerei erst richtig nach seiner zweiten Italienreise.
Jedoch beeinflusste ihn auch das klassizistische Werk eines Ingres. Ohne Nicolas Poussin mit seinen arkadischen Bildern ist sein Werk nicht zu denken.
Leichtfertig den Salonmalern zugeordnet, wurde lange nicht erkannt, wie modern die Kompositionen von Puffs de Chavannes sind und das ihnen alles Schwülstige fremd ist.
Modern klingt immer ein wenig seltsam und pauschal. Jedoch orientierte sich nicht nur van Gogh an Puvis de Chavannes, sondern auch Maurice Denis.
Picasso kopiert gar seinen Genevieve-Zyklus.
Camille Corot ist ein Hauptvertreter der Schule von Barbizon. Diese Schule war die Zündschnur für die impressionistische Bombe, die so vieles in der Kunst – bis in unsere Zeit – radikal verändern sollte.
Was jedoch nicht sagt, dass jede dieser Neuerungen Bestand haben werden. A priori wird Einigens mit der Zeit revidiert und Anderes gar gänzlich verschwinden. Waren die Bilder von Millet wie die Ährensammlerinnen oder die Steinklopfer von Courbet zu ihrer Entstehungszeit als sozial realistische Bilder radikal so wirken sie, wie gerade die Ährenleserinnen, heute eher sentimental-romantisch.
Vier schöne kleine Gemälde von Corot sind im Musée des Beaux-Arts in Lyon zu sehen. Das stille Atelierbild mit einer jungen Frau und drei Landschaften.
Mit diesem kleinen Corot sind wir ganz nah am Impressionismus. Landschaft, Figuren, Häuser und Bäume sind geradezu hingehaucht.
Im Malprozess eines Corot ist die flirrende Unschärfe eingebaut, die bei Monet endgültig durchbricht. Die Unschärfe als Prinzip wird uns noch beschäftigen. Es ist nicht das Sfumato der alten Meister um den Hintergrund verschwimmen zu lassen, oder die Kontur malerisch aufzulösen. Die Unschärfe geht über das gesamte Bild und wird Prinzip. Das Prinzip einer Impression.
Das Leben ist ungerecht! Jean Achard hat noch nicht mal einen ins Deutsch übersetzten Wikipediaeintrag.
Er ist einer der sehr vielen, sehr guten Landschaftsmaler, über die hinweggesehen wird. Er gehörte zur Schule von Barbizon. Das Musée des Beaux-Arts in Lyon hat kein sehr großes, dafür ein um so feineres Bild von ihm in der Sammlung. Dieses hat eine so einfache wie bestechenden Komposition.
Klar gemalter, tiefer, leuchtend blauer Himmel. Wie auch bei Courbet das Schatten-Licht-Schatten-Licht Prinzip des Himmels.
Und hier sind sie! Drei kleine und schöne Bilder von Monet – zu sehen im Museum der schönen Künste zu Lyon.
Es sind keine Ikonen des Meisters. Aber diese Gemälde verdeutlichen sehr gut, was mit dem Begriff Impressionismus gemeint ist. Vor allem das Bild mit der Brücke und dem sich diffus im Wasser spiegelnden Sonnenlicht hatte es mir angetan. Das Meerbild dagegen mit seiner Maltechnik des Impasto und seiner Pinselführung hatte eine van Goghsche Komponente.
Sehr fein und gekonnt ist der blühende Baum gemalt.
Das Leben ist nicht immer ungerecht. Die vom Menschen gemachte Kunstgeschichtsschreibung aber oft.
Eugene Carriere war ein Zeitgenosse der Impressionisten. Zu seinen Freunden gehörten Auguste Rodin, Paul Gauguin. Seine Schüler waren unter anderem Matisse und Derain. Lebendig durch die Kunstwelt spazierend war er nicht nur beliebt und bekannt, sondern – wenn auch spät – erfolgreich und galt als einer der bekanntesten Künstler seiner Zeit. Nach seinem Tod geriet er schnell ins Abseits und später überdeckten die omnipräsenten Impressionisten sein Werk. Bei Licht und aufmerksam betrachtet lassen sich Bezüge zu Gerhard Richter herstellen. Wird es ihm auch so ergehen?
Warum also wird Eugene Carriere in unserer Zeit so stiefmütterlich behandelt? Wir wollen farbige, wenn nicht gar bunte Bilder sehen. Ist es dies?
Langsam fing es mit Manet und Monet an. Van Gogh wurde schon intensiver und Maurice de Vlamick, der Begründer des Fauvismus, trieb es noch doller. Danach der Expressionismus und letztlich die Pop-Art. Die Pop-Art ließ letztendlich das Fass der Farbigkeit überlaufen. Spätestens seit dem haben es gedeckte Töne in der Malerei schwer.
Drei schöne Beispiele von Carriere sind im Museum zu Lyon zu sehen. Ein seltenes Ereignis für das Auge eines deutschen Museumsbesuchers.
Gauguin`s Gemälde ist farbig und nicht bunt. Auch dieses Bild ist ein wirkliches Ereignis und eine der Stellen zum Innehalten, denn das Museum in Lyon ist einen Besuch wert!
(Herrliche Tage) Nave Nave Mamana ist ein Bild, das auf seinen ersten Tahitiaufenthalt zurückgeht.
Als er die auf der Südseeinsel entstandenen Gemälde nach seiner Rückkehr in Paris ausstellte, wurde er von Künstlerfreunden gefeiert. Die kleinbürgerliche Kunstöffentlichkeit und selbst ernannte Kunstexperten überschütteten ihn jedoch mit hämischen Spott. Heute würde ihm die neue „Politische Korrektheit“ mit ihrer postkolonialen Selbstgerechtigkeit zum Verhängnis.
Auch Gauguin musste bis an sein Lebensende warten, ehe er einigermaßen von seiner Kunst (über)leben konnte. 1900 schloss der Maler einen Vertrag mit dem Kunsthändler Ambroise Vollard, der später auch den jungen Picasso vertreten sollte. So bekam Gauguin noch drei Jahre – bis zu seinem frühen Tod – ein schmales, aber immerhin regelmäßiges Einkommen. Zahlte man schon kurz nach seinem Tod 3000 Francs für ein Gauguin-Gemälde, so soll in 2015 das Gemälde „Nafea faa ipoipo“ für 300 Millionen Dollar nach Katar gegangen sein.
Dem Museum in Lyon kommt der Verdienst zu als erstes Museum überhaupt bereits 1913, zehn Jahre nach seinem Tod dieses Gemälde erworben zu haben.
Ein weiteres „Frühchen“ in dem Lyoner Museum für feine Künste. Diesmal ein Manet vor dem Manet wie wir ihn kennen.
Cavaliers espagnols malte er mit 28 Jahren. Aus der Zeit stammt auch der Absinthtrinker, der auf dem Salon von 1859 abgelehnt wurde und heute in der Carlsberg Glyptotek hängt. Bei diesen zwei Bildern fällt sofort die Unschärfe ins Auge, welche wir von Eugene Carriere kennen. Diese hat, auch in seiner Farbigkeit, nichts mit dem späteren und viel farbigeren impressionistischen Farbauftrag Manets zu tun.
Das später gemalte Porträt von Marguerite Gauthier-Lathuille ist im Duktus schon näher an dem späteren Manet, aber seltsamerweise auch recht monochrom im Verhältnis zu anderen Werken von seiner Hand aus dieser Zeit. Es wurde 1902 erworben. Eventuell entsprach dieses Bild dem individuellen Geschmack des damaligen Erwerbers.
Der dritte Manet des Museums in Lyon ist eine malerische Skizze oder ein im frühen Stadium abgebrochenes Gemälde.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Manet so skizzenhaft ein Bild begann und es dann Schritt für Schritt verdichtete. Da dieses Bild ziemlich spät und in dem Jahr, in dem auch „Beim Pere Lathuille“ entstand, kann man sehr schöne Bezugspunkte erkennen. Die Hände der Madame und auch ihr Kostüm weisen die gleiche flüchtig-impressionistische Pinselführung auf.
Bei dem Lyoner Bild fehlt jedoch jegliche Verdichtung, so das ich vermute, es handelt sich um ein begonnenes oder aber verworfenes Gemälde.
Natürlich ist auch der impressionistische Maler-Onkel mit den Bonbonfarben bei dem Fest der Künste dabei.
Ja, ich weiß, diese Äußerung ist despektierlich. Ich liebe Renoir und gerade deswegen darf ich ihn so nennen, kommt er mir doch wirklich wie ein Onkel vor.
Auch ihn trifft die harte Realität des Künstlerlebens. Kritiker verreißen ihn nicht, im Gegenteil loben sie seine Bilder ob ihrer Frische und Lebendigkeit. Trotzdem war er so arm, dass er nicht jeden Tag essen konnte. Auch als er dann einen Kunsthändler hatte, gab dieser Renoir nur die nötigen Mittel, damit er sich ein Atelier leisten konnte. Zum Lebensunterhalt blieb kaum etwas übrig.
Mitte 30 änderte sich seine Lage, als er vermögende Leute kennenlernte und diese porträtierte.
Außerdem ist Renoir ein Sonderfall innerhalb der Gruppe der Impressionisten. Bauten seine Mitstreiter im Verlauf ihres Lebens die impressionistische Malweise aus und brachten diese zu einem Höhepunkt oder gar darüber hinaus, so fand Renoir den Mut sich „rückwärts“ zu orientieren. Nach einem Italienaufenthalt und der intensiven Beschäftigung mit Raffael und zu Hause auch mit Ingres, lies er vom Spontanen ab und mühte sich um klare klassizistische Formulierungen in seinem Werk. Das beste Beispiel aus dieser Zeit sind „Die großen Badenden“. Sein farbenfrohes Kolorit blieb jedoch erhalten.
Renoir ist ein schönes Beispiel, um einen Diskurs über die Linearität der Kunstentwicklung zu beginnen. Dies soll hier jedoch nicht mein Thema sein.
Freilich sind im Lyoner Kunstmuseum nicht alle Impressionisten beisammen. Aber einer durfte nicht fehlen.
Edgar Degas mit seinen berühmten Tänzerinnen. Das Bild „Danseuses sur la scene“ ist nicht groß, aber ein Großes in jedem Fall. Wieder ein skizzenhaftes, jedoch trotzdem reizvolles Bild. Wenn ich weiter oben im Text über Degas behaupte, er ist den Impressionisten zuzuordnen, kann dies bald schon anders sein. Denn eigentlich ist er genauso gut ein Realist. Jedenfalls wenn man seine Bilder im sozialen Kontext betrachtet.
Die Tänzerinnen sind wie ein künstlerisches Programm und fallen uns zuerst ein, wenn wir seien Namen hören.
Pierre Bonnard stand immer ein wenig am Rand des Kunstgeschehens. War jedoch ein sehr erfolgreicher Maler.
Vielleicht gerade deshalb attackierte Christian Zervos – als Sprachrohr der Moderne – die Ausstellung von Bonnard 1947 in Paris scharf und unerbittlich.
Er war der Meinung, man müsse gegen den Impressionismus rebellieren. Jeder Fortschritt habe radikal zu sein und sich immer mehr von der Realität zu entfernen, als in ihr zu verharren.
Zervos gab das Werkverzeichnis von Picasso heraus und stand vermeintlich auf der Seite der Avantgarde.
Nichts Neues in der Welt des Kunstdiskurses möchte man meinen, denn auch heute gibt es derartige Scheingefechte. Mit dem Unterschied, dass es zu Zeiten Bonnards wirklich noch eine „Entwicklung“ der Kunst gab. Heute leben wir in einem absoluten Pluralismus der Stile. Die stilistische Entwicklung im alten Sinne hat mit dem Bild des schwarzen Quadrats von Kasimir Malewitsch mehr oder weniger ein Ende gefunden.
Freilich gehörte Bonnard wirklich zwei Welten an. Einerseits der Künstlergruppe die Nabis zusammen mit Gauguin, aber auch Duchamp, der seinen Ekel vor der Affekt haschenden Kunst offen artikulierte, und andererseits Picasso, der mit seinen Les Demoiselles d`Avingnon 1907 die Kunst kubistisch zerlegte.
Bonnard war ein Maler der intimen Privatheit und hatte wahrlich nichts Spektakuläres an sich.
Solche Künstler haben es in der Wahrnehmung immer schwer, sind mir aber allemal lieber als die Lärmenden, jüngst als „geniale Dilettanten“ bezeichneten Zeitgenossen. Auch die stillen Künstler vermögen Kollegen zu inspirieren.
In Amerika mehr geschätzt als in seinem eigenen Land hinterließ Bonnard deutliche Spuren in den Werken von Morris Louis und Mark Rothko.
Bonnards Freund Eduard Vuillard darf in der Sammlung natürlich nicht fehlen. Stilistisch sehr nah bei seinem Freund, hier jedoch auch nur mit einem kleinen skizzenhaften Bild vertreten.
Dieses aber macht diese Sammlung sympathisch, wird man doch an anderen Orten oft durch die großen „Kunstklötze“ erschlagen. Zusammenfassend ist die Sammlung dieser Epoche im Musée des Beaux-Arts in Lyon eine Lyrische. Wenn ich das so beschreiben darf.
Bevor man in die Räume der Nachimpessionistischen Kunst gelangte, sah man eine Einzelausstellung des Malers Edouard Pignon. Pignon ist stark von Picasso beeinflusst. Für mein Gefühl fast zu stark. Und um es offen zu sagen. Ich habe meine Schwierigkeiten mit diesen Bildern und auch ihre Farbigkeit der 50iger Jahre trifft nicht meinen Nerv.
Hat man Pignon bewältigt, kommt man in die abstrakt, kubistisch-surrealistische Abteilung.
Auch hier interessante Beispiele und fast ein kunstgeschichtlicher Diskurs. Robert und Sonia Delaunay sind mit schönen Arbeiten vertreten. Robert begann als Neoimpressionist und kam über den Kubismus und den blauen Reiter zu einer eigenen Bildsprache. Er kann als einer der ersten abstrakten Maler gelten. Seine Kreisbilder sind zum Markenzeichen geworden. Wie es späterhin noch viele Markenzeichenmaler geben wird, die dann durchaus auch im Kunstmarkt so wahrgenommen und gebraucht werden.
Von manchem Künstler/mancher Künstlerin werden diese Markenprodukte bis zum Erbrechen produziert und auch so vermarktet. Das Coca Cola Zeitalter hat begonnen.
Ein Schatz. Die Violine von Braque, dem ewig in Picassos Schatten Stehenden.
Auch er begann im späten Impressionismus und hatte eine fauvistischen Schaffensphase, ehe er zusammen mit Picasso den Kubismus erfand. Im Gegensatz zu Picasso, der in riesigen Schritten seine Kunst weiter vorantrieb, malte Braque nach einer schweren Verwundung im Ersten Weltkrieg vornehmlich Stillleben und entwarf Glasfenster für Kirchen. Er nahm an drei Dokumenten teil und kann als einer gelten, die auch nach dieser Auszeichnung ihren großen Namen behielten. Denn viel Dokumentateilnehmer sind im Kunst-Nirwana verschwunden.
Epigonen gibt es viele. Nicht nur in der Kunst. Und manche ihrer Arbeiten sind erst auf den zweiten Blick vom Vorbild zu unterscheiden.
Rembrandt bildete seine Nachahmer höchstpersönlich aus und verkaufte deren Bilder. Aber diese Methode zur Renditesteigerung konnte mächtig schief gehen. Govert Flink war ein gelehriger Schüler seines Meisters und ausgesprochen geschäftstüchtig, denn er nahm seinem Lehrer später lukrative Aufträge weg. Das gelang, weil sich der Schüler marktopportunistisch benahm. Dies ist auch seinen Bildern auch deutlich anzusehen.
Nicht jeder Schüler ist stark genug sich von seinem Meister wirklich zu lösen. Egal ob in Ost, wo man viele kleine Heisige malen sieht. Oder in West, wo zahllose Epigonen vom Malerfürsten Lüpertz mit dicken Ringen auf den Fingern in einschlägigen Bars anzutreffen sind.
Auch im Kunstmuseum von Lyon ist ein herrliches Beispiel von Epigonentum in geradezu musealer Qualität zu bewundern. Der Pole Henryk Hayden begann wie so viele als Postimpressionist. Umgezogen nach Paris traf er jedoch auf Picasso und schon war es um ihn geschehen. Wie eine Kölner Galeristin über einen ihrer Künstler einmal bemerkte, dieser sei ein Beuys für Arme, so ist – lästerlich – Henryk Hayden ein Picasso für Arme. Ordentlich gemacht, aber mit falscher Signatur.
Wie auf Zuruf ist dann auch Picasso`s Gemälde „Femme assise sur la plage“ zur Stelle um meine Hypothese Henri Laurenz betreffend zu illustrieren.
Auch ein zweiter Picasso ist in der Sammlung. Als wäre es Programm, sind es keine spektakulären Stücke aber durchaus Werke, die man gern sieht.

Natürlich darf im Reigen Fernand Leger nicht fehlen. Zwei schöne Beispiele vervollständigen den Kunstlehrpfad.
Und dann sind einige Stücke zu sehen, die das Bild breiter auffächern und die nicht zum engen Kanon gehören, den zahlreiche Museen anbieten.
Andre Masson, auch vom Kubismus kommend, vermochte es sich von diesem Stil zu lösen. Er schloss sich den Surrealisten an. Masson ist ein Vorreiter des Unbewussten in der Kunst und hatte durchaus starken Einfluss auf deutsche Maler wie zum Beispiel Bernhard Schulze.
Man konnte aus der Surrealistengruppe raus fliegen, wenn man sich nicht an die Vereinbarungen hielt.
Lyrisch dichten – das geht für eine Surrealisten gar nicht. Dies tat aber Victor Brauner – der aus Rumänien stammende – und wurde aus dem erlauchten Kreis ausgeschlossen. Auch Brauner ist weitestgehend in Vergessenheit geraten. Sein Werk umkreist die Pole Giorgio de Chirico, Max Ernst oder auch Yves Tanguy.
In den subtileren Werken scheint auch Paul Klee Pate gestanden zu haben. Insgesamt ein sehr heterogenes Werk mit einigen herausragenden Arbeiten. Lyon hat eine besonders schöne Arbeit in seiner Sammlung.
Daneben – wirklich passend – ein geborener Kubaner mit chinesischem Vater. Wifredo Lam ist mit zwei sehr schön zusammenpassenden Gemälden vertreten.
Paris war in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ein Sammelbecken für Künstler. Man musste einfach dort sein, wie heute in New York oder auch Berlin. Erstaunlich ist jedoch, wie schnell die Bedeutung dieser europäischen Kunstmetropole verblasst ist. Impulse, die so wirken wie damals, sendet diese Stadt schon lange nicht mehr aus.
Picasso führte den jungen Künstler in die surrealistischen Kreise ein. Lam übernimmt zwar viele Elemente der damaligen europäischen Avantgarde, behält aber kultische Symbole seiner Heimat bei und übersetzt sie in die Moderne.
Da hilft auch nicht das deutsche Wikipedia und selbst der französische Eintrag ist äußerst mager. Pierre Bettencourt überzeugt mich wirklich nicht.
Freilich ist es subjektiv. Ich finde sein Werk dürftig dekorativ und in dem was er darstellt pubertär. Dies ist einer der wenigen Ausrutscher, die ich in der Sammlung ausmachen konnte.
Auch er darf natürlich nicht fehlen. Chagall. Zugegeben eine schöne Arbeit, die sich für einen Wandkalender gut eignet. Sie merken, er ist nicht mein Fall. Zu dem naiv-süßlichen Darstellungen habe ich nie einen rechten Zugang finden können.
Zum Schluss für heute noch einen Roul Dufy. Flott hingeworfen und dann überschreiten wir die Schwelle zu Informell.