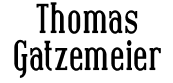Irrtum bei der Bildanalyse
Jean Clouet und Hans Holbein im Bildvergleich
Der Irrtum bei Bildanalysen beruht zumeist auf einem Vorurteil oder dem verfestigten inneren Bild des Betrachters.
C.G. Jung hat dieses Phänomen als kollektives Gedächtnis bezeichnet. Wobei der Begriff Kollektiv auch kleinere Einheiten und Interessengruppen umfassen kann.
Diese inneren Bilder prägen ein Wahrnehmungsmuster das zum Ausdruck kommt, wenn Bilder beweisbar falsch gedeutet werden. Derlei Muster führen zur einer Verallgemeinerung, die nicht zuletzt auf die Prägung durch ein spezifisches soziales Milieu zurückgeführt werden muss.
Zum Beispiel kann sich in der Wissenschaft eine sogenannte „professorale Arroganz“ extrem negativ auf die Forschungsqualität auswirken.
Denn durch eine Berufung wird eine Qualifizierung quasi „amtlich“ festgestellt muss aber nicht gegeben sein.
Das Wahrheit und Wissenschaft nicht immer zusammengehören, dürfte bekannt sein. Dies gilt umso mehr für die Wissenschaften von der Kunst, da sich die Kunst nicht mit unserem Verständnis von Wahrheit oder Richtigkeit messen oder beurteilen lässt.
Text aus: Meisterwerke der Kunst von Wilhelm Bode (1905)
Neuerlich hat man in Frankreich versucht, eine französische Malerschule des fünfzehnten Jahrhunderts zu rekonstruieren. Die Ausstellung der „Primitifs Francais“ zu Paris hat nur bewiesen, dass hier patriotische Begeisterung doch ein wenig über das Ziel hinaus geschossen ist. Ebenso wenig wie es damals ein einiges Frankreich gab, existierte eine französische Malerschule. Aus den Niederlanden, welche in der nordischen Kunst die Führung übernommen hatten, haben die Besten ihr Bestes geholt.
Aber nirgends ist die Malerei zu gleicher Kraft und Originalität durchgedrungen wie im Norden. Es fehlt Tiefe, Ernst und Geschlossenheit. Der Franzose stilisiert zumeist im dekorativen Sinne und mit ausgewähltem Geschmacke. Aber die eigentliche Energie zur Verkörperung einer originellen Idee hat ihm damals gefehlt. Das hat er sich für die neuere Zeit aufbewahrt, als durch die Revolution endlich das Haus gesäubert war und frische Kräfte aus dem Volke zuflossen.
Denn wie im Achtzehnten, war schon im 15. Jahrhundert die Kunst in Frankreich durchaus höfisch geworden. Die große Dekoration der Paläste hatte die Teppichweberei übernommen, und so war für die Malerei nichts weiter als die Miniatur übrig geblieben. Sie hatte Gebetsbücher zu illustrieren und Miniaturporträts der Könige und Fürsten zu malen. Das war auch die Aufgabe des Jean Clouet gewesen, der im Beginn des Cinquecento der erste Hofmaler am Hofe des Herzogs von Burgund war und 1518 Hofmaler Franz des Ersten wurde.
Die Zahl der Porträtminiaturen die man ihm neuerdings zuschreibt, schwillt mehr und mehr an. Sie zeichnen sich durch vornehme Kühle und Pikanterie in bleichen, zarten Tönen aus, während sein Rivale Corneille de Lyon lebhaftere Farbigkeit zeigt. Mit großer Liebe ist das Detail ausgeführt. Die feinen Lichter auf den Spitzen, die glitzernden Perlenschnüre stehen eigentümlich heiter und lebhaft dem bleichen Fleischton, dem unbewegt kühlen Ausdruck im Gesicht gegenüber.
Trotzdem ist das Gesicht nicht, wie etwa bei Holbein, als große Farbfläche gedacht, sondern der Künstler sucht die weichen, runden Formen mit Geschick herauszumodellieren.
Im Begleittext und der Bezeichnung der Heliogravüre nach dem Gemälde von François Clouet „Elisabeth von Österreich“ ist ein Versehen aufgetreten. Im Text und auf der dazugehörigen Heliogravüre ist der Maler mit Jean Clouet angegeben. Dieser war der Vater von François aber nicht der Urheber des hier beschriebenen Gemäldes.
Ein Fehler von Wilhelm Bode 😉
Ich danke einer aufmerksamen Leserin!
Freilich sollen meine Einlassungen das Lebenswerk von Wilhelm Bode nicht schmälern. War er doch einer der Mitbegründer des modernen Museumswesens. Mit seinem Werk „Meisterwerke der Malerei“ eröffnete er weiten Kreisen der Bevölkerung einen Zugang zur Bildenden Kunst.
Dieser mich befremdende Vergleich könnte also auf eine kognitive Illusion zurückzuführen sein. Selbst wenn der Irrtum offenbar wird, verdrängt er nicht die Illusion des Schreibers, er hätte recht. Der Verfasser des Textes als auch die beschriebenen Künstler sind nicht mehr erreichbar.
Also transferieren wir die Sache auf den gegenwärtigen Wissensstand zu Irrtümern und Falschbehauptungen. Bei dieser Bildanalyse aus der Frühzeit der modernen Kunstwissenschaft wird eine Behauptung aufgestellt, die bei genauer Betrachtung der Gemälde eindeutig widerlegbar ist.
Würde derjenige, der die Behauptung in die Welt gebracht hat- so er erreichbar wäre – diese revidieren? Vermutlich nein.
Denn auch er würde es großartig finden, wenn andere ihre Meinung ändern, wäre jedoch nicht im Geringsten bereit, seine eigene zurückzunehmen.
Eigentlich müsste er dankbar sein und sich für die Bemühungen des Hinweisgebers bedanken. Aber so war der Mensch damals und er ist auch heute so.
Die Psychologen Leonid Rozenblit und Frank Keil haben herausgefunden, Zitat:
„Wer nichts weiss, macht sich selten etwas vor über seine Fähigkeiten, wer wenig weiss, hingegen schon.“
Und da sind wir bei dem eigentlichen Problem. Was ist wenig wissen? Studierte man zum Beispiel Kunstwissenschaft. Weiss man dann alles über Kunst? Ich glaube nicht. Ich beschäftig mich seit über 50 Jahren mit ihr und habe erst jetzt Jean Clouet bewusst war genommen. Der Irrtum bei der Bildanalyse war mir jedoch schon bekannt und wurde von mir im Text „Ein Porträt kann Bildnis sein“ thematisiert.
Um so glücklicher bin ich, dass in unserer Branche Unwissen eher kein großes Unheil anrichten kann. Unheil aber schon. Man kann Menschen, so es sich um „lebendige Künstler“ handelt, Schaden zufügen. Ihren Ruf beschädigen oder sie einfach nerven.
Aber im März des Jahres 2022 gibt es viel größere Probleme. Und doch bedenke man! Im Kleinen fängt alles an. Sein wir achtsam und gestehen Irrtümer ein. Zumal einen Irrtum bei der Bildanalyse. Oder wenn man einfach einem Gerücht aufgesessen ist. Alles ist im Fluss.
Da steht noch im Raum, wie ich auf solcherlei Themen komme.
Seit vielen Jahren beschäftige ich mich immer mal wieder mit Malereicollagen. Das Prinzip ist simpel, ufert aber manchmal aus. Ich besitze einige, wenn nicht viele, Mappenwerke der Heliogravüren von Wilhelm Bode. Nun nehme ich mir immer wieder ein Blatt vor und gehe ganz intuitiv auf das vorhandene Motiv ein. Das bezeichnet man gelegentlich als Kunst.
Manchmal treibt mich jedoch die Neugier. Wer war die Porträtierte. Der Maler. Wie sieht das mir eventuell unbekannte Gemälde im Original aus. Daraufhin entstehen auch Texte wie dieser über den Irrtum bei der Bildanalyse.
Nachtrag.
Bode behauptete um 1900 es gäbe keine französische Malerschule. Heute nennt man die entsprechende Epoche Schule von Fontainebleau