Gute Kunst gibt es nicht
Behauptungen zu einer Behauptung.
Bei der Beschäftigung mit dem Kunstbegriff ist es unvermeidlich, die strapazierte Redewendung „Kunst kommt von Können“ zu hinterfragen, um letztendlich zu entdecken – gute Kunst gibt es nicht.
Das Können oder anders ausgedrückt die Fähigkeit, imstande zu sein, etwas zu vollbringen, was der Sache nach einen Zweck erfüllt, ist der Ausgangspunkt jeglicher Kunstfertigkeiten.
Dies gilt für die ärztliche Kunst ebenso wie für die Liebeskunst. Für die Baukunst und die Kunst zu musizieren ohnehin. Der Künstler jedes Faches beherrscht sein Metier mindestens zu dem Maß, welches notwendig ist, um seiner jeweiligen Profession Genüge zu tun. Kunstfehler können in der Medizin tödlich sein und sind in jedem Fall auf die Abwesenheit von Kunst zurückzuführen. Die fehlende Kunst eines Seiltänzers wird mit Absturz und den entsprechenden Folgen quittiert.
Versagen ist dem Erdbewohner eigen, ohne dass die Auswirkungen immer derart drastisch und unmittelbar manifest werden wie in den oben benannten Fällen.
Als Baukunst feste Hüllen zu bezeichnen, in denen sich Menschen schlecht oder erniedrigt fühlen, ist gang und gäbe.
Häufig sind Neubauten von Museen, die der Kunst dienen sollten, Opfer des zeitgenössischen, kunstlosen Größenwahns. Zweckfreie Leerräume unmenschlichen Ausmaßes sollen imponieren und lassen den Besucher ratlos zurück, da sie zweckloser als jedes noch so gigantische Grabmal unserer Vorfahren sind. Sie sind lediglich raumgewordenes Imponiergehabe.
Brücken, die einstürzen, verlieren spätesten nach diesem Ereignis ihren „Kunststatus“.
Andere bauliche Hinterlassenschaften werden nach wenigen Jahrzehnten abgerissen und vernichten nicht nur Geld, sondern belasten auch die Umwelt. Haften muss weder der Auftraggeber noch der den Bau Ausführende. Bauwerke, die Kunst genannt werden und auch solche sind, bewahren diese Aura über eine Zeit, die lediglich durch den natürlichen Zerfall beschränkt ist. Die Menschen identifizieren sich mit ihnen und werden im besten Falle eins mit den Gebäuden, in denen sie Wohnen und von denen sie umgeben sind.
Andere vom Menschen als Kunstwerke bezeichnete Hervorbringungen sind dienend.
Nehmen wir als Beispiel die Wasserkunst. Kunstvolle Anlagen zur Be- und Entwässerung sind seit Tausenden Jahren bekannt und haben die städtische Zivilisation und die moderne Landwirtschaft erst ermöglicht. Diese Kunst teilt sich in zwei Bereiche. Ich nenne sie der einfachhalber, die nützliche und die schöne Wasserkunst. Im besten Falle ist das Nützliche mit dem Schönen vereint.
Die Initialzündung meiner hier aufgeschriebenen Gedanken verursachte das Gradierwerk von Bad Kösen.
1779/80 erbaut, funktioniert es bis in die gegenwärtige Zeit in allen seinen Teilen. Allein durch Wasserkraft angetrieben diente es der Salzgewinnung und in der gegenwärtigen Zeit medizinischen Zwecken. Dieses Gradierwerk ist einerseits seines Zweckes wegen ein geniales und noch heute einmaliges Kunstwerk und vermag auch in technischer Hinsicht zu überzeugen. Das eigentliche Gradierwerk ist ein monumentales Holzgerüst, welches mit Reisigbündeln belegt ist durch und über die salzhaltige Sohle geleitet wird. Das zum Zeitpunkt des Baus wertvolle Salz lagerte sich ab und konnte nach einer gewissen Zeit „geerntet“ werden. Die Ablagerung geschieht durch gradieren – also durch die Anreicherung des Salzgehaltes der Sole durch Verdunstung.
Gradierwerke sind ein typisches Beispiel des Prinzips Form follows function.
Also ist der Funktion und der Ästhetik nach das Gradierwerk von Bad Kösen Kunst. In jeder Hinsicht große und bedeutende Kunst. Gute Kunst gibt es nicht, – große jedoch schon. Und Bedeutende. Es gibt übrigens ein Genre, welches sich freiwillig Kleinkunst nennt.
Im Gegensatz zu dem soeben beschriebenen bedeutenden Wasserkunstwerk lässt der Brunnen auf dem Eutritzscher Markt in Leipzig jegliche Kunst vermissen.
Formal nicht an eine Übung im Leistungskurs BK der Klassenstufe 8 heranreichend ist er ein Schandfleck und dysfunktional wie die Platzgestaltung insgesamt.
Der Mensch wendet sich ab und es entsteht eine Ödnis, die auch durch ein Coronatestzentrum nicht gefüllt werden kann. Von der Ressourcenverschwendung solcher jeder Kunst entbehrenden Bausünden nicht zu sprechen.
Spätestens hier stellt sich die Sinnfrage: Ist dies „schlechte Kunst“? Nein. Denn gute Kunst gibt es nicht, – folgerichtig kann es auch keine schlechte Kunst geben.

Gute Kunst und schlechte Kunst kann es also nicht geben, weil sich schlecht und Kunst dem Sinne nach gegenseitig ausschließen.
Was schlecht ist, kann nicht zugleich Kunst sein. Andererseits gibt es Kunstwerke, die bedeutender sind als andere Kunstwerke. Diese Betrachtungsweise ist jedoch oftmals zeitabhängig, weil der subjektiven Wahrnehmung des Menschen unterworfen. Wahrnehmungen sind wiederum von kulturellen Prägungen bestimmt. So sind Künstler und deren Theoretiker einerseits höchst subjektiv und äußern ihre Meinung oftmals aufgrund von Partikularinteressen.
Die Kunst – in Bezug auf die bildende Kunst – ist spätestens seit Beginn der sogenannten Moderne eine Behauptung und wird durch Schichtung zu Humus.
Dabei werden spätere Grabungen ergeben, welche dieser Schichten fruchtbar waren und welche toxisch oder zumindest Inhaltsstoffarm. Auf alle Fälle wird sich herausstellen, dass vieles mit dem Schild Kunst versehene diese Bezeichnung nicht verdiente.
Bei oberflächlicher Recherche trifft man auf nichtssagende Kunstbegriffserklärungen wie „schöpferisches Gestalten“ „Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt“, „kreativer Prozess“ etc. Erörterungen zur handwerklichen Ausführung und deren kritische Hinterfragung nimmt man eher nicht wahr.
A priori beschäftigt sich die zeitgenössische Kunsttheorie, obwohl genau das Gegenteil nötig wäre, vorwiegend mit Bild- und Inhaltsbeschreibungen, anstatt den Versuch zu unternehmen, den Kunstwert von Artefakten zu hinterfragen.
In einer Epoche der ichbezogenen Oberflächlichkeit müssten die Hervorbringungen des Kunstbetriebes einer sorgsamen Analyse unterzogen werden. Wenn sich Kunst und Kunsttheorie gleichermaßen auf Klickratenniveau bewegen, ist der Nutzen für die Gesellschaft letztendlich bei null und der Betrieb macht sich überflüssig. Da sich die Kunsttheorie mehr und mehr um den Betrieb als um deren Produkte kümmert, verlässt sie die Kunst als Gegenstand der Betrachtung und somit den eigentlichen Diskurs.
Cristian Saehrendt wagt in der Neuen Züricher Zeitung mit seinem Artikel So viel schlechte Kunst! Aber woran soll man sie erkennen?
Dieser Versuch einer Analyse kann sich jedoch auch nicht vom Kunstbegriff trennen. Zeigt jedoch wichtige Parameter auf, über die zu sprechen wichtig wäre.
Weitere Überlegungen eines Praktikers zur Kunst lesen Sie hier.
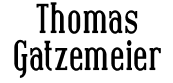
















Gute Kunst gibt es nicht? Folglich auch keine schlechte Kunst?
Gutekunst gibt es sehr wohl, als Familiennamen, der angeblich aus dem Nordschwarzwald stammt.
Aber ohne Scherz: Die fruchtlose Debatte über gute und schlechte (Bildende) Kunst ist wohl nur eine Fortsetzung der ausgelutschten Debatte in der Musik über E- und U-Musik, die man auflösen zu können glaubte im Unterschied von guter und schlechter Musik. Alles hilfloses Bemühen.
In einer längeren Reflexion zur Selbstvergewisserung über den Kunstbegriff habe ich vor einigen Jahren geschrieben (unveröffentlicht):
Ja, was ist denn eigentlich Kunst? Was ist überhaupt mit dem Wort gemeint?
„Kunst“ scheint mir in der Begriffswelt etwas ähnliches zu sein wie das Chamäleon in der Tierwelt. Etwas, das in jeder Situation und für jeden Betrachter anders erscheint. Ich kann hier nur versuchen, das Phänomen historisch zu erfassen, wohlgemerkt den Begriff, nicht die Tätigkeit Kunst.
Also gehen wir so weit zurück in der Geistesgeschichte, respektive der überlieferten Kulturgeschichte, bis wir auf etwas stoßen, das uns als eine erstmalige Erscheinung, ohne Vorgänger, entgegentritt. Ich erblicke dies in dem historischen Substrat für das antike Begriffskonstrukt, das griechisch technai eleutherioi, lateinisch artes liberales heißt, deutsch: Freie Künste. Gemeint ist die Vorstellung von einer Lebenstätigkeit, die allein einem freien Menschen zukommt: nicht auf Zwecke gerichtet, nicht auf Erwerb angelegt, nicht zur Unterhaltssicherung dienend. Ein solcher freier Mensch ist übrigens erstens männlich (Frauen sind nicht mitgemeint), zweitens materiell unabhängig (andere arbeiten für ihn), drittens mächtig (diese Verhältnisse kann er durchsetzen), mithin ein Angehöriger einer Oberschicht in einer Sklavenhaltergesellschaft, der keiner Berufsarbeit nachzugehen braucht. Und die gemeinten Tätigkeiten und Themen haben etwas mit Bildung und geistigen Dingen zu tun: Studienfächer, wie wir heute sagen würden. Deren antiker Kanon in der griechischen Polis umfasst: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Künste? Wir stutzen! Die einzige Kunst nach heutigem Verständnis ist dabei die Musik. Und so ist es wahrhaftig. Die Musik und nur die wird als eine freie Kunst, eine Kunst der Freien (Menschen) gewertet. Andere Künste nach unserem Verständnis zählten zu den Handwerken, den technai banausoi bzw. artes mechanicae, also nützlichen Künsten, so elaboriert sie auch sein mögen. Aus dieser gesellschaftlichen Spaltung heraus wurde der bis heute virulente Begriff des Banausen geprägt: Der bánausos, der Ofenarbeiter, wurde zum sozial abwertenden Synonym für alle, die den Lebensunterhalt durch eigener Hände Arbeit schweißtreibend verdienen mussten. Nämlich durch das Gegenteil von geistiger Arbeit und das Fehlen geistiger Interessen. Die gesellschaftliche Spaltung am Begriff entlang verlor sich erst sehr langsam, je weitere Kreise Bildung in der Gesellschaft zog, bis sich nach Jahrhunderten zwischen der Renaissance und der Aufklärung ein Kunstverständnis der „Schönen Künste“ Bahn brach und aus dem Banausen ein Schimpfwort für den Uninteressierten, den geistig trägen Spießbürger, die Dumpfbacke wurde. Dieser Begriffswandel selber dürfte eine Folge umfassender gewordener geistig-ästhetischer Bildung gewesen sein.
Bis dahin waren aber bereits Wortzusammensetzungen mit Kunst in der deutschen Sprache durch Jahrhunderte entstanden und bis heute tradiert, die ein Kunst-Verständnis eher vernebeln als klären: Reitkunst und Wasserkunst, Schreibkunst und Rechenkunst, Lebenskunst und Liebeskunst, Kriegskunst und Gartenkunst, Kochkunst und Fahrkunst, Heilkunst und Zauberkunst und was derlei Künste mehr sind. Gemeinsam ist diesen Begriffen die prägende Vorstellung, dass auf jeglichem Gebiet ein geübtes, gut beherrschtes Können wesentlich ist, eben die Kunstfertigkeit, die den Könner vom Nichtkönner unterscheidet.
Klar geschieden davon verlangt das Konzept der Schönen Künste ein wesentlich ästhetisches Verstehen des Kunstbegriffs und des Kunstschaffens, ausgehend von Selbstverständnis und Intention des frei schaffenden Künstlers, der kein Auftragnehmer von Kirche, Adel oder Großbourgeoisie mehr ist, sondern ein Schöpfer von eigenen Gnaden und auf eigene Rechnung, ein Schöpfer von L’art pour l’art. Dass die Kunst trotzdem immer noch nach Brot geht, will ich hier nicht weiter thematisieren…
Also kommt Kunst von Können? Nein, Kunst kommt wirklich nicht von Können, auch wenn das etymologisch ganz korrekt ist. Aber das war einmal auf der Höhe des Themas und ist es längst nicht mehr. Seit die Bedeutung von „Kunst“ sich verengt hat auf das heutige Verständnis, wie auch abzulesen ist am Wechsel von „kunstlich“ zu „künstlich“ im 13. Jhdt. zu „künstlerisch“ im 18. Jhdt., kommt Kunst von Wollen. Basta! Wollen ist vorgängig, Können nachrangig. Zwar ist ein Ringen um das Können zweifellos eine Existenzform des Künstlers, aber um das Wollen braucht es solches Ringen ja gar nicht. Entweder ist das Wollen mit Macht präsent, dann ist es Müssen, oder es ist nicht präsent, dann ist Können allein wenig belangvoll. Das Geheimnis des Könnens liege sowieso im Wollen, meinte Giuseppe Mazzini, der radikaldemokratische Vordenker einer politischen Schönheit, Gutheit, Wahrheit für ein geeintes Europa der Völker um 1848/49 herum.
…
Vorhin habe ich gesagt, Kunst entstehe im Kopf des Künstlers, im Hirn, im Verstand, im Geist, im Gefühl, in der Seele, in der Emotion, wie auch immer man die Verortung benennen wolle.
Im Kopf des Künstlers? „Hier stock ich schon“, wie Goethe seinen Faust stocken lässt beim Sinnieren über „Wort“ und „Tat“. Doch nicht allein im Kopf des Künstlers entsteht sie, sondern vielleicht im ganzen Körper? Jeder Begriff der Verortung ist ein verbales Hilfskonstrukt für ein Phänomen, das schwer zu fassen ist. Ein gleiches Hilfskonstrukt ist die Verwendung der Bezeichnungen für die herkömmlich unterschiedenen Kunstsparten: etwa Dichtung, Malerei, Musik oder Tanz. Längst sind die Spartengrenzen aufgelöst und den Körper als Ausdrucksmittel, Darstellungsmedium, Kunstobjekt und letztlich Ursprungsort des Kreativen (vulgo „Bauch“) in Einem zu verstehen, zweifelt kaum mehr einer an. Jedenfalls stammt aller Kunstausdruck aus einem schöpferischen Potenzial, das im Innersten jedes Menschen angelegt ist – nicht nur weil Joseph Beuys behauptet, jeder Mensch sei ein Künstler oder Ben Vautier grübelnd fragt, ob denn alles Kunst sei – und entweder zum Ausdruck drängen oder brach liegen kann.
…
Drei Jahre, nachdem ich diesen Text geschrieben habe, stoße ich unversehens auf einen Gedanken, den der ZEIT-Redakteur Peter Kümmel in ganz anderem Zusammenhang wie nebenbei äußert: Das Tier lebt, der Mensch macht immer nur Kunst.
(Das vollständige Zitat: „Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Der Mensch beobachtet sich beim Handeln, das Tier kann das nicht. Das Tier ist mit seinem Körper identisch. Der Mensch hingegen ist der Schauspieler und Zuschauer seiner selbst. Das Tier lebt, der Mensch macht immer nur Kunst.“ DIE ZEIT vom 3.Februar 2022)
Und als nähme er an diesem Gedankengang teil, fragt Daniel Kehlmann in wieder anderem Zusammenhang: „Tendiert womöglich jede Intelligenz ab einer gewissen Höhe zur Kunst?“
Vielleicht ist das mein Schlüssel zum Kunst-Verständnis. Das Tier ist eingeschlossen in seine Lebensrealität, es kann nicht heraustreten. Der Hund mag den Mond anheulen; aber das Anheulen des Mondes erschöpft sich im Anheulen. Der Mensch kann den Mond bedichten, das Tier kann es nicht. Der Mensch als Darsteller und Zuschauer seines eigenen Denkens, Wollens und Handelns lebt in und durch die Schleifen und Volten und Arabesken seiner Reflexion, weist Bedeutungen zu und türmt Metaebenen über Metaebenen. Er kann nicht anders, und er kann dadurch aus seiner Lebensrealität heraustreten. Was das mit Kunst zu tun hat? Kunst ist eine Existenzweise, die radikal geschieden ist vom bloßen Existieren. Als menschliche Intelligenz-Leistung und als Begriff dafür mag Kunst in die Welt getreten sein, als ein altsteinzeitlicher Mensch beobachtet hat, wie ein anderer altsteinzeitlicher Mensch seine ockerfarbigen Handabdrücke beschwörend auf einer Felswand hinterließ, dies spontan verstand und es ihm gleichtat: Wollen, Handeln, Werten und Nachahmen schafft Kunst.
Man kann es auch so sagen: Kunst kommt von Kunst; darin stimme ich mit vielen Künstlern überein. Ursprung eines Bildes ist immer ein Bild. Helmut Heißenbüttel formulierte 1970: „wer ein Bild macht hat andere Bilder gekannt”. Womit eigentlich bereits alles gesagt ist.
Ich hätte mir viele Worte sparen können. Aber einer wertenden Unterscheidung von guter und schlechter Kunst bin ich immer noch nicht nähergekommen.