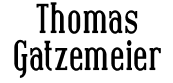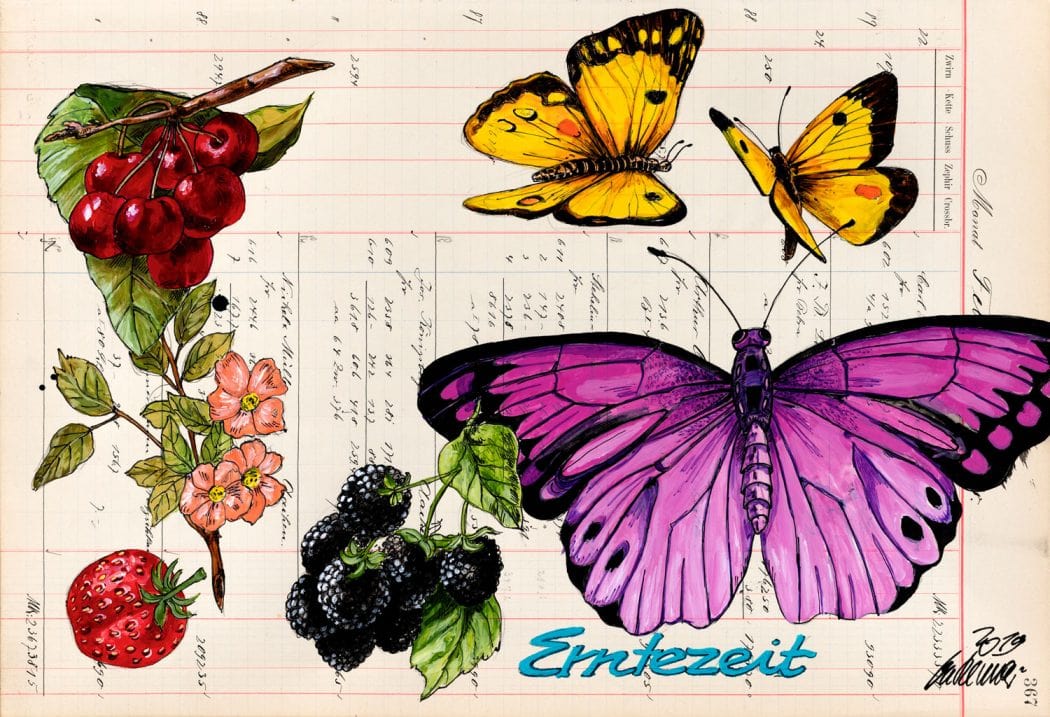Der Reformationsaltar in Wittenberg – Provokante Überlegungen eines Betrachters
Ein „Merkbild“ des Glaubens oder Propaganda?
Luthers Forderung an die Malerei war klar: Sie solle als „Merkbild“ dienen – als eingängige, verständliche Darstellung der zentralen Inhalte des Glaubens.
Verständlich, denn das Bild sollte nicht mehr verführen, sondern belehren. Das Herz des Betrachters erreichen – nicht dessen ästhetisches Empfinden überfordern.
Doch bei näherer Betrachtung stellt sich die Frage: Ist diese Forderung tatsächlich ein Bruch mit der vorreformatorischen Tradition? Hatte christliche Kunst nicht immer schon die Aufgabe, das Testament sichtbar zu machen, Geschichten zu erzählen, die Bibel zu illustrieren?
Von Giotto zu Cranach, eine Kontinuität: Der Reformationsaltar in Wittenberg
Ein Blick auf Giottos Abendmahl, das rund 200 Jahre vor dem Wittenberger Altar entstand, zeigt überraschend wenig Unterschiede. Johannes ruht an der Brust Jesu – so, wie es die Tradition will. Judas sitzt am Rand. Die Gruppe der Jünger ist ruhig versammelt.
Natürlich hat sich über die Jahrhunderte die Darstellungsweise verändert: Die Komposition wurde lebendiger, der Raum realistischer, die Gesten sprechender. Aber die inhaltliche Grundstruktur bleibt erstaunlich stabil.
Ist der Reformationsaltar in Wittenberg sichtbar gemachtes Wort oder Rückzug aus der Kunst?
Die Theologie bietet eine eigene Perspektive auf das Bild. Der Kunsthistoriker Hans-Christoph Dittscheid schreibt:
„Im verbum visibile verfolgt Cranach eine eigenständig zu nennende Kategorie von Malerei, die gegenüber der an Italien orientierten Renaissance veränderte Qualitäten erkennen lässt. Eingedenk der sokratischen und christlichen Skepsis gegenüber dem schönen Schein und seiner ethischen Wertigkeit, schraubt sie die ästhetischen Ansprüche bewusst zurück, um mit der Botschaft und allgemeinen Verständlichkeit des sichtbar gemachten Worts den inneren Menschen und sein Herz zu erreichen.“
(Hans-Christoph Dittscheid: Sichtbar gemachtes Wort, 1993)
ANZEIGE
Schauen Sie! Kleine Kunst-Geschenke zum sensationellen Preis vom Künstler signiert.
4 Wochen Rückgaberecht
ANZEIGE - ENDE
Eine schöne theologische Deutung – aber ist das nicht auch eine intellektuelle Verklärung gestalterischer Zurückhaltung?
Zwei Altäre – zwei Welten?
Als Maler sehe ich andere Dinge. Und ich frage mich: Warum ist der Unterschied zwischen dem Reformationsaltar in Wittenberg (1547) und der Kreuzigung in der Stadtkirche Weimar (1555) so frappierend?
Gerade einmal acht Jahre trennen die beiden Werke – und doch wirken sie wie aus zwei unterschiedlichen Jahrhunderten. Während das Weimarer Werk eine klare Komposition, starke Figuren und einen emotional aufgeladenen Ausdruck zeigt, wirkt das Wittenberger Altarbild wie ein spätes Relikt der Gotik – flach, gedrängt, figürlich typisiert.
Und das, obwohl beide Werke aus der Werkstatt Cranach stammen.
ANZEIGE
Schauen Sie! Kleine Kunst-Geschenke zum sensationellen Preis vom Künstler signiert.
ANZEIGE - ENDE
Reformatorische Einflüsse oder Werkstatt-Routine?
Woran liegt das? Waren es unterschiedliche Auftraggeber? Theologische Vorgaben? Oder schlicht Unterschiede im Anspruch?
Besonders auffällig ist die Präsenz bekannter Persönlichkeiten auf dem Wittenberger Bild: Martin Luther selbst sitzt als Jünger am Tisch – eingebettet in die Heilsgeschichte. Daneben sein Drucker Hans Lufft, Philipp Melanchthon bei der Taufe eines Kindes, der damalige Pfarrer der Kirche – und vermutlich sogar Lukas Cranach selbst.
Die reformatorische Elite versammelt sich am Tisch des Herrn – mit einem vermeintlich festen Abo fürs Himmelreich.
Der Reformationsaltar in Wittenberg – Selbstinszenierung oder Glaubenszeugnis?
Ist das noch ein religiöses Bild – oder bereits eine politische Inszenierung? Ist das gläubige Bekenntnis – oder Marketing?
Natürlich, auch in der Kunst der italienischen Renaissance ließen sich Stifter in religiöse Szenen integrieren. Doch bei Cranach wirkt es nicht wie eine stille Teilnahme, sondern wie eine demonstrative Aneignung des Sakralen. Der reformatorische Gedanke – bildlich zementiert durch Personenkult.
Und wo bleibt die Malerei?
Trotz theologischer Deutungsangebote fehlt mir eines: das sogenannte „Herzblut“. Die innere Notwendigkeit, ein Bild zu schaffen, das über das Funktionale hinausgeht. Das Abendmahl in Wittenberg wirkt nicht wie ein künstlerischer Höhepunkt, sondern wie ein Werk, das mehr der Lehre als der Kunst verpflichtet ist.
Bei der Betrachtung des Reformationsaltars in Wittenberg stellt sich mir eine provokante Frage: Ist dieses gefeierte Werk der Reformationszeit nicht vielleicht eine eher mittelmäßige Leistung aus der Cranach-Werkstatt?
Fazit eines kritischen Betrachters und Malers
Ich stehe auf der Seite der Malerei. Und ich sehe einen Altar, der mehr behauptet als zeigt. Ein Werk, das theologisch gefeiert wird – aber künstlerisch hinter seinen Möglichkeiten bleibt.
Vielleicht liegt gerade darin seine unfreiwillige Ehrlichkeit: Die Reformation war ein geistiger und gesellschaftlicher Umbruch – aber kein Triumph der Malerei.
LESEN SIE AUCH: DER WEIMARER CRANACHALTAR