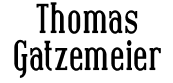Anhaltische Gemäldegalerie Dessau – klein, aber fein
Der wahre Liebhaber der bildenden und schönen Künste sucht bei der Betrachtung von Kunst nicht Spektakel, sondern Stille und innere Einkehr.
Doch diese Qualitäten bieten viele der großen, insbesondere der neu errichteten Museen kaum noch.
Ob in Dresden, Berlin oder im Städel in Frankfurt – oft wird man dort Teil einer durchgetakteten Menschenmaschinerie, angelockt von raffinierten Marketingkampagnen. Reisegruppen werden durch die Räume geschleust, Menschen, die im „normalen“ Leben selten mit Kunst in Berührung kommen, „machen“ dann eben auch mal Museum. Die Kunst wird dabei zur Kulisse degradiert.
Ganz anders die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau – ein stiller, fast intimer Ort, der in vieler Hinsicht eine wohltuende Ausnahme bildet.
Untergebracht im Schloss Georgium, einem klassizistischen Bau aus dem späten 18. Jahrhundert, verschmilzt hier Architektur, Parklandschaft und Sammlung auf harmonische Weise. Das Georgium entstand ab 1780 im Auftrag von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, der es als Landsitz und Ort der geistigen Muße plante. Die Galerie beherbergt heute eine exquisite Sammlung alter Meister, darunter Lucas Cranach, Hans Holbein und Anthonis van Dyck – Werke, die in der bescheidenen, aber würdevollen Atmosphäre des Hauses auf besondere Weise zur Geltung kommen.
Das Raumkonzept erlaubt es dem Besucher, sich auf das einzelne Werk zu konzentrieren. Nichts ist überdimensioniert, nichts will dominieren.
Ganz im Gegensatz dazu steht etwa das Museum der bildenden Künste Leipzig welches eher für martialische Parteitage geeignet scheint. Zwar beherbergt es eine bedeutende Sammlung, doch der 2004 eröffnete Neubau – entworfen von den Berliner Architekten Hufnagel, Pütz und Rafaelian – ist für diese eine Katastrophe und missachtet deren Bedürfnisse.
Die Architektur dieses „Glaskastens“ kann nur als übermäßig monumental beschrieben werden. Ein Bau, der mit seiner kühlen, fast sakralen Überhöhung kaum Rücksicht auf das Bedürfnis nach Kontemplation nimmt. Kritiker wie der Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt bemängelten die „inhuman repräsentative Geste“ des Baus, der dem bürgerlichen Ursprung der Leipziger Sammlung (sie entstand 1837 aus einem Zusammenschluss kunstsinniger Bürger) kaum gerecht wird. Statt Geborgenheit vermittelt das Gebäude Leere, statt Nähe zur Kunst Distanz.
In Dessau hingegen begegnet man der Kunst auf Augenhöhe. Kein musealer Pomp, keine architektonische Selbstdarstellung, sondern ein Raum, der der Sammlung dient – und nicht umgekehrt.
Freilich habe ich schon lange nicht mehr die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau besucht, aber oft an sie gedacht. Denn 1976 oder 1977 war ich als Leipziger Student der schönen Künste mit einem Freund an diesem Ort. Dabei hat sich ein bestimmtes Gemälde in meinem Langzeitgedächtnis eingeprägt. Wir diskutierten sehr lebhaft über das Gemälde von Aelbert Jacobsz Cupy mit dem Orpheus und die Tiere und den darauf zu sehenden „halb abgeschnittenen Elefanten“. Lernten wir doch an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in den Kompositionstechniken Anschnitte bewusst zu setzen, um den Betrachter nicht zu irritieren. Ein weites Feld mit vielen Aspekten. Kurzum, der Elefant irritiert, weil er mittig durchgeschnitten erscheint und dadurch seltsam wirkt.
Das verrückte jedoch ist, dass ich dieses Gemälde seitenverkehrt mit sämtlichen Details abgespeichert hatte und verwundert war es jetzt in seiner „Richtigseitigen“ Realität zu sehen.
Die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau und das für mich wichtigste Gemälde – der Fürstenaltar von Lucas Cranach d.Ä.
Man steht einfach nur da und staunt. Das kann so nur in Dessau geschehen, wo man mitten im Georgium, zwischen Park, Enten und gepflegter Stille plötzlich vor einem echten Hochkaräter der deutschen Kunstgeschichte steht.
Der Marienaltar, auch Dessauer Fürstenaltar genannt, stammt von niemand Geringerem als Lucas Cranach dem Älteren– Hofmaler, Lutherfreund, Geschäftsmann, Werkstattchef, und – ja – ein ziemlicher Meister seines Fachs.
Das Triptychon stammt aus der Zeit um 1509 – also noch vor der Reformation. Die katholische Welt war intakt, Maria durfte noch in voller Pracht verehrt werden, und Cranach lieferte das passende Bildprogramm gleich mit.
In der Mitte: Maria mit dem Kind in höfischem Glanz
Im Zentrum des Altars thront Maria mit dem Jesuskind – ganz klassisch, umgeben von Engeln und eingebettet in eine Szenerie, die einer höfischen Fantasie gleicht. Alles glänzt und funkelt: feinste Stoffe, zarte Haut, weiche Wellenhaare – Cranach zeigt hier nicht nur religiöse Verehrung, sondern auch die Raffinesse einer aufstrebenden Künstlerdynastie.
Links und rechts: Adelige Andacht
Auf den Flügeln sehen wir die Dessauer Fürstenfamilie – fromm kniend, in schicker Kleidung und mit eindeutigem Wunsch nach Ewigkeit. Das ist Repräsentation auf hohem Niveau, aber eben auch Familienbild. Was wir heute als frommes Kunstwerk lesen, war damals auch ein Statement: Seht her, wir haben’s geschafft – auf Erden und im Himmel bitte auch! Und wie auch heute müsste darunter stehen: Und ihr habt das alles bezahlt.
Typisch für Cranach: Er malt die Damen mit feinem Profil, langen Hälsen, mandelförmigen Augen – dieser Stil ist sofort erkennbar. Ein bisschen Stil-Ikone, ein bisschen Bildprogramm. Und wunderschön. Bei diesem Triptychon ist davon auszugehen, dass der Meister selbst am Werke war und die Werkstatt im Hintergrund blieb.
Wieso ist dieses Werk in der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau?
Ursprünglich war das Retabel für die Marienkirche in Dessau bestimmt – dort hing es, bis es (wie so viele Kunstwerke) im 19. Jahrhundert in die Sammlung der Anhaltischen Gemäldegalerie überführt wurde. Heute ist es dort der heimliche Star. Obwohl kein Gedränge herrscht, so ist man doch irritiert, wenn eine Betrachterin ihr Smartphone plärren lässt, über das man den Audioguide hochladen kann.
Was mich an Museen, besonders den kleineren, begeistert sind die Entdeckungen.
Das Doppelbildnis des Berthold Tucher und der Christina Schmidtmayer aus dem Jahr 1484 ist ein herausragendes Beispiel spätgotischer Porträtkunst und wird dem anonymen Künstler Meister des Landauer Altars zugeschrieben. Die Darstellung dieses Nürnberger Patrizierpaares hat für mich einen besonderen Reiz, da sie von einer Natürlichkeit und einem unerwarteten Realismus geprägt ist. Die detailreiche Darstellung zeugt von einer tiefen psychologischen Einfühlung des Malers.
Die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau beherbergt viele Werke der altdeutschen Malerei.
Das Götterfest im Grünen von Cornelis van Poelenburgh und der barocke Traum vom sinnlichen Leben – welcher Ort wäre passender als die Anhaltische Gemäldegalerie mitten in einem idyllischen Park?
Das Gemälde Götterfest in einer Landschaft von Cornelis van Poelenburgh (1594–1667) ist ein üppiger Reigen aus Nymphen, Satyrn, Putti und Göttern – ein barockes Bacchanal unter freiem Himmel. Inmitten einer idealisierten Natur feiert eine heitere Schar die Sinnlichkeit des Lebens. Alles scheint in Bewegung: Musik, Tanz, Liebesspiel – ein Paradies antiker Lebensfreude.
Poelenburgh, der längere Zeit in Rom wirkte, steht mit diesem Werk in enger Verbindung zur Kunst Nicolas Poussins(1594–1665). Auch Poussin malte Bacchanale und den Triumph des Bacchus – doch seine Darstellungen wirken oft disziplinierter, geordneter, fast philosophisch durchdacht. Wo Poussin das Dionysische in eine klassische Form zwingt, lässt Poelenburgh es blühen: farbig, spielerisch und körperlich.
Beide eint der Blick zurück auf die Antike – doch sie interpretieren ihn unterschiedlich. Poussin will belehren, Poelenburgh verführen. Sein Götterfest ist ein visuelles Lustspiel, ein Ausflug in eine Welt, in der Natur, Körper und Rausch eins sind.
Uns sollte es nachdenklich machen, dass diese Bilder in einer Zeit entstehen, die auch durch Kriege, Umbrüche und religiöse Strenge geprägt ist, zeigt: Der Traum vom arkadischen Dasein war mehr als Dekoration. Er war ein Gegenbild – ein Wunsch nach Schönheit, Freiheit und Lebensfreude.
Der Turmbau zu Babel – Geschichte und Bedeutung eines Bildmotivs
Der „Turmbau zu Babel“ zählt zu den ikonischsten Bildmotiven der westlichen Kunstgeschichte. Sein Ursprung liegt im Alten Testament, genauer im 1. Buch Mose (Genesis 11,1–9), wo erzählt wird, dass die Menschheit, noch vereint in Sprache und Wille, in der Ebene von Schinar einen Turm bis in den Himmel bauen wollte. Gott sah dies als anmaßenden Akt menschlicher Hybris, verwirrte die Sprache der Menschen und zerstreute sie über die ganze Erde. Die Geschichte gilt seither als mythologische Erklärung für die Vielfalt der Sprachen – und zugleich als Allegorie auf menschlichen Hochmut, technologische Überheblichkeit und kulturellen Zerfall.
Kunsthistorische Rezeption
Das Motiv des Turmbaus zu Babel wurde über die Jahrhunderte hinweg immer wieder neu interpretiert. In der christlichen Kunst des Mittelalters diente es häufig als mahnendes Symbol, oft als Miniatur in Bibelhandschriften oder als Fresko in Kirchen. Die Blütezeit des Motivs liegt jedoch in der niederländischen Renaissance.
Pieter Bruegel d. Ä. (um 1563)
Seine beiden berühmte Version (Wien, Kunsthistorisches) ist bis heute stilprägend. Bruegels „Babelturm“ erscheint als monumentales, unvollendetes Bauwerk, eine Mischung aus Kolosseum und Kathedrale – Sinnbild menschlicher Gigantomanie und gleichzeitiger Ohnmacht. Die Bauhütte Babel wird hier zum Spiegelbild damaliger Gesellschaften und ihrer imperialen Bestrebungen.
Das Motiv wurde unzählige Male aufgenommen – geschätzt über 500 Werke, wenn man auch Buchillustrationen und moderne Adaptionen zählt. In der Barockzeit, im 19. Jahrhundert, in der Romantik und nicht zuletzt im 20. Jahrhundert begegnet man Babel als politischer oder metaphysischer Allegorie. Der Turmbau zu Babel – Geschichte und Bedeutung eines Bildmotivs
Der „Turmbau zu Babel“ zählt zu den ikonischsten Bildmotiven der westlichen Kunstgeschichte. Sein Ursprung liegt im Alten Testament, genauer im 1. Buch Mose (Genesis 11,1–9), wo erzählt wird, dass die Menschheit, noch vereint in Sprache und Wille, in der Ebene von Schinar einen Turm bis in den Himmel bauen wollte. Gott sah dies als anmaßenden Akt menschlicher Hybris, verwirrte die Sprache der Menschen und zerstreute sie über die ganze Erde. Die Geschichte gilt seither als mythologische Erklärung für die Vielfalt der Sprachen – und zugleich als Allegorie auf menschlichen Hochmut, technologische Überheblichkeit und kulturellen Zerfall.
Waren Bernhard Heisigs Adaptionen des Turmbaus zu Babel die letzten großen Babel-Darstellungen?
Tatsächlich ist Bernhard Heisig (*1925; †2011), einer der zentralen Künstler der DDR, wohl der letzte bedeutende Maler, der sich in großformatiger und komplexer Weise mehrfach mit dem „Turmbau zu Babel“ auseinandersetzte. In seinem Werk wird der Turm zum düsteren Mahnmal der Geschichte – Heisig verbindet das biblische Motiv mit den Traumata des 20. Jahrhunderts: Faschismus, Krieg, Exil und eventuell sogar dem Mauerbau. Sein Babel ist kein theologischer Ort, sondern ein historischer – von Chaos, Lärm und Zerstörung durchzogen. Er zeigt Menschenmassen, Verwirrung, Maschinenfragmente und ein Symbol für den scheiternden Fortschritt in einer ideologisch aufgeladenen Welt.
Heisigs Babel könnte auch als ein Spiegel der DDR-Gesellschaft – ein Ort der Sprachlenkung, der Einmischung in Denkprozesse, der Macht über Kommunikation gelesen werden.
Damit setzt er einen markanten Schlusspunkt hinter ein Jahrhunderte altes Motiv – das, obwohl von der Religion inspiriert, immer auch politische und gesellschaftliche Deutungen zuließ. Natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass Heisig sich opportunistisch in der 2. Deutschen Diktatur bewegte und nicht nur Mitglied der SED, sondern auch verschiedener wichtiger Gremien war.
Trotz dieser nicht zu verschweigenden Tatsachen bleibt jedoch sein Werk.
Der „Turmbau zu Babel“ bleibt ein kraftvolles Bild für das menschliche Streben nach Größe – und dessen notorische Begrenztheit. Über Jahrhunderte hat sich das Motiv als Spiegel kollektiver Hybris bewährt, als Metapher für Größenwahn, Sprachverwirrung und das ewige Missverhältnis zwischen technologischem Können und moralischer Unreife.
Heute wäre dieser Turm so aktuell wie selten – doch statt ihn neu zu denken, bauen wir fröhlich an neuen Ruinen. Unsere Türme heißen jetzt CO₂-Bilanz, Lithiumabbau und Hyperschallrakete. Die Sprachverwirrung ist zurück, diesmal algorithmisch optimiert: Fake News, Kriegspropaganda, PR-Sprechblasen. Man versteht einander nicht mehr – was aber nicht weiter auffällt, weil sowieso keiner mehr zuhört.
Während die Gletscher kollabieren und der Äquator brennt, träumen wir lieber vom Mars. Die Kunst? Hat sich längst ins selbstreferenzielle Schneckenhaus zurückgezogen. Die Babylonier wollten den Himmel erreichen – wir erreichen mit Glück noch die nächste Documenta. Und selbst dort meißelt man den Weltuntergang in ästhetisch anspruchsvolles Styropor.
So bewegen wir uns weiter zwischen internationaler Kunstmesse und Klimakatastrophe – und nennen es Diskurs. Verspachteln im Großformat Farbe und kleben auf immer wiederkehrende Art Stroh auf Großformate, vor die ein Brett – von Uecker benagelt – von der Zukunft kündet. Also bleibt die Anhaltische Gemäldegalerie eine Oase in der zeitgenössischen Kunstwelt.
Die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau ist nicht nur „klein, aber fein“ – sie hat erstaunlich viel zu bieten.
Wer aufmerksam liest, wird bemerkt haben, wie viele Aspekte ich in diesem Blog bereits angerissen habe. Um Ihre Geduld nicht über Gebühr zu strapazieren, wollen wir nun ein wenig zügiger durch die Sammlung streifen.
Neben der bemerkenswerten Sammlung altdeutscher Kunst beherbergt die Galerie auch eine Vielzahl niederländischer Meisterwerke. Diese sogenannten „Alten Holländer“ sind in dichten Blockhängungen präsentiert – ein kuratorischer Kniff, der zwar Konzentration verlangt, dafür aber visuelle Dialoge zwischen den Werken ermöglicht. Einzelstücke treten dabei deutlich hervor und sind geschickt in das Gesamtkonzept der Sammlung eingebettet.
Es sind oft kleine Schätze zu entdecken – auch wenn nicht alle von Bruegel selbst stammen, so doch in seiner Art oder aus seinem Umkreis.
Und so stellt sich ganz nebenbei die alte Frage: Muss ein Bild von einem großen Namen stammen, um ein großes Bild zu sein? Oder genügt es, dass es gut ist – kompositorisch, malerisch, atmosphärisch?
Ein weiteres Highlight sind die barocken Gemälde, die mit sicherem Gespür für Proportion und Wirkung an ganzen Wänden in der Anhaltischen Gemäldegalerie arrangiert wurden.
Werke unterschiedlicher Provenienz treten hier in einen lebendigen Austausch: Niederländische, italienische und deutsche Künstler begegnen sich auf Augenhöhe. Die so gestalteten Räume erinnern an kunstvolle Schatzkammern – sinnlich, dicht, konzentriert.
Die Anhaltische Gemäldegalerie Dessau und die Allegorien der Sinne
Die Darstellung der fünf Sinne – Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten – hat in der Kunstgeschichte eine lange Tradition. Besonders zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert waren sie beliebte Bildthemen, die nicht nur der Belehrung dienten, sondern auch ein willkommenes Mittel waren, um nackte oder halb entblößte Körper in einem moralisch akzeptierten Kontext darzustellen. Heute, in Zeiten der absurden Prüderie wäre auch dies nicht möglich, denn der malende Mann an sich und sein „männlicher Blick“ unterliegt einem feministischen Bann.
Selbst in Zeiten strenger religiöser und gesellschaftlicher Konventionen – insbesondere während der Gegenreformation – war die Nacktheit an sich ein Problem, wenn auch nicht ein solches wie heute.
Doch sobald sie damals „allegorisch“ gemeint war, wurde sie kunsttheoretisch legitimiert. Eine nackte Frau war dann nicht einfach eine nackte Frau, sondern beispielsweise die personifizierte „Sehkraft“, die sich einem Spiegel zuwendet, oder die Allegorie des Geschmacks, wie sie genüsslich in eine Frucht beißt. Die Sinne wurden in solcher Weise nicht nur ästhetisiert, sondern mitunter auch erotisiert – ein kalkulierter Balanceakt zwischen Tugend und Lust der heute in vielen Fällen nicht akzeptiert, sondern zensiert würde.
In diesen Allegorien wurden Frauenkörper meist idealisiert dargestellt: weich gezeichnet, mit glänzender Haut, in lasziven Posen – ein klarer Appell an das Auge des Betrachters. Dass gerade das Sehen, also der Blick selbst, allegorisiert wurde, ist dabei fast schon ein ironisches Spiel der Maler mit dem Kunstbegriff. Oft treten die Sinne auch gemeinsam auf, in Serien oder mehrteiligen Gemälden, wie etwa in niederländischen oder flämischen Werkzyklen des 17. Jahrhunderts. Oft auch von namentlich nicht bekannten Meistern.
Solche Bilder entstammen einem kultivierten Kunstverständnis, in dem Bildung, Begierde und Bildfindung Hand in Hand gingen.
Allegorien erfüllten im Barock nicht nur eine symbolische Funktion – sie waren auch eine Art bildnerische Tarnkappe. Was auf den ersten Blick nur als Tugend oder Konzept erschien, war in Wahrheit oft ein ästhetischer Vorwand für das, was viele Sammler und Auftraggeber sich eigentlich wünschten: Schönheit, Sinnlichkeit, ja sogar Verführung – aber bitte in gelehrter Verpackung.
Diese doppelte Lesbarkeit macht Allegorien bis heute spannend. Sie sprechen das Auge an und fordern zugleich den Verstand heraus. Oder um es mit einem Augenzwinkern zu sagen: Wer klug nackt sein wollte, war in der Allegorie gut aufgehoben.
Weiterführendes zum Thema:
Das Gemälde Visus (lateinisch für „Sehen“) von Hans Christoph Schürer, das mir in der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau begegnete, führt den Betrachter nicht nur tief hinein in die Bildtraditionen der Kunstgeschichte. Es öffnet zugleich ein Fenster zu einer kunsttheoretischen Auseinandersetzung, die in unserer Gegenwart besonders brisant ist: der Diskussion um den sogenannten „männlichen Blick“.